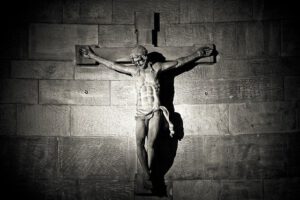Leider folgt bis auf den heutigen Tag, die Mehrheit unserer Familie mit zunehmender Selbstständigkeit der drei Töchter nicht meinen Vorstellungen, sondern den Anregungen unserer weit gereisten Oma. Ich müsste mich als Senior in dieser Lage wahrlich sehr bedauern, hätte mir die Natur nicht zum Ausgleich eine reiche Fantasie geschenkt. Ihr verdanke ich es, mir einfach eine Geschichte einfallen zu lassen, in der sich die sperrige Familie endlich einmal darauf einlässt, auf meine Wünsche ein zu gehen. In der folgenden Erzählung werdet Ihr davon hören, wie ich es schaffe, meine Frau und die große Familie, zu einer Bergwanderung rund um Oberstdorf zu bewegen:
Ich kenne niemand, der es mir vergönnte, all die vertrauten Wege wieder zu gehen, auf denen ich früher mit meiner Frau kräftig ausgeschritten bin. Welch ein Vergnügen kann es bereiten, im Allgäu zu wandern, die entzückenden Bergblumen und die emsigen Bienen zu bewundern, den würzigen Duft des Heues und frisch gemähten Grases zu riechen, begleitet von der Musik abgestimmter Glocken der Kühe auf den weiden. Was könnte meine ganze Familie erleben, wenn sie endlich einmal meinen Spuren folgte? Auf geht´s! Sofia, unsere muntere Enkelin, läuft wie immer, auch auf unserer Fantasiereise einige Schritte voraus. Es ist ihr wichtig, die Erste zu sein, der niemand folgen kann. Der Höhenweg um Oberstdorf führt in einem schattigen Waldstück steil bergab. Um den Wanderern sicheren Tritt zu verschaffen, gibt es mit Pfählen gesicherte Stufen. Sofia hüpft, vergnügt-jauchzend, die Stufen hinunter. Sie ist mit ihren zehn Jahren bereits eine gute Sportlerin und bewegte sich nicht nur in den Bergen, sondern auch auf ihrem Einrad und im Wasser sehr geschickt.
Ihr vierjähriger, blondschopfiger Bruder Niclas, den ich an der Hand führe, will seiner Schwester nicht nachstehen und bedrängt mich mit den Worten. „Opa hüpf, Opa hüpf, Opa hüpf!“ Ich gebe schließlich dem Drängen des aufgeregten Knaben nach und hüpfe mit ihm von Stufe zu Stufe den Weg hinunter, bis von unserer Familie nichts mehr zu sehen ist. Niclas jauchzt vor Vergnügen. Prustend, mit klopfendem Herzen und hochrotem Kopf, bleibe ich nach einiger Zeit stehen, und überlege mir, ob es nicht noch eine andere Möglichkeit gibt, sich weniger anstrengend fort zu bewegen?
Zum Glück fällt mir ein, dass ich seit meiner Kindheit in Träumen fliegen kann. Zu Niclas gewendet sage ich bedeutungsvoll: »Dein Opa kann nicht nur hüpfen, sondern auch fliegen! «Niklas schaut ungläubig zu mir herauf: »Nur Vögel können fliegen«, behauptet er hartnäckig. Ich entgegne: »Opa Franz kann aber fliegen und wenn Du recht mutig bist, werde ich Dich mitnehmen. Du musst mir nur auf den Rücken sitzen, und Dich dann an meiner Jacke gut festhalten«. Niklas, immer noch ungläubig, an diesem Unternehmen aber höchst interessiert, bietet sich zum Flug an. Ich nehme in »huckepack«, mache einige leichte Schwimmbewegungen und hebe ab. »Halte Dich gut fest«, rufe ich ihm nochmals zu.
Wir schweben, ohne die Füße zu benutzen, leicht über die Stufen des Weges hinunter. »Schön, kreischt Niclas!» »Opa, flieg weiter, flieg weiter! bettelt er. « Offensichtlich hat er keine Angst. Ich fliege mit ihm nahe über die Stufen, damit uns ein möglicher Sturz nicht zu sehr schaden kann. An einer Wegbiegung können wir tief ins Tal hinuntersehen, und die in der Sonne liegenden Wiesen mit den prächtigen Blumen bewundern. Ich mache eine kräftige Bewegung, und „hui“, fliegen wir, zunächst aus Sicherheitsgründen in Bodennähe, dann aber frei wie ein Vogel, weit über die Lichtung hinaus. Es bereitet uns einen Riesenspaß, den Aufwind am Hang zu spüren, und in großen Kreisen. wie ein Drachenflieger, hin und her zu segeln. Schließlich haben wir genug, denn es bläst uns in der Höhe ein ziemlich kühler Wind um die Ohren. Ich halte Ausschau nach einem geeigneten Landeplatz und setze, als ich in der Ferne Segelflugzeuge erkenne, dort zur Landung an. Die Segelflieger staunen nicht schlecht, als wir plötzlich auftauchen und ohne Flugzeug fliegend, unbeschadet landen. Sie überschütten uns mit Fragen: »Wie macht ihr das? « Ich entgegne: »Von Kindheit an kann ich fliegen. Ich weiß aber nicht wieso« Und zum Leiter der Flugschule gewandt: »Sie sind doch ein erfahrener Pilot und sollten mir erklären können, warum ich fliegen kann? «Er konnte es nicht. Wir bedanken uns dennoch, und winken den freundlichen Segelfliegern noch einmal zum Abschied zu.
Gegen den Protest von Niclas, geht es langsam zu Fuß den Höhenweg zurück. Wir finden Sofia und die Familie, die sich zu einer Vesperpause niedergelassen hatten, und berichten ausführlich, was sich inzwischen ereignete. Sie können es einfach nicht verstehen, dass Opa fliegen kann. Niclas behauptet aber steif und fest: »Ich bin auf Opas Rücken wirklich geflogen und es war wunderschön, auch wenn ihr es nicht glauben wollt!« Oli und Arthur, kräftige, bergerfahrene, kritische Männer, wünschten sehr neugierig geworden, von Opa einen weiteren Beweis seiner Flugkünste. Sie äußerten: »Wenn Du schon seit Deiner Kindheit im Traum geflogen bist, müsstest Du mindestens noch eine Geschichte erzählen können«. »Nichts einfacher als das«, entgegnete ich. Opa räuspert sich kurz, streicht mit einer Hand durch die Haare und beginnt:
Ich war einmal in England und wanderte dort durch Wälder und Felder einer schönen Landschaft, die an einem sonnigen Tag den Blick weit über die sanften Schwingungen der Hügel bis zur Küste und dem Meer freigab. Vor mir, auf der Höhe, sah ich eine Schule. Sie trotzte offensichtlich schon lange Wind und Wetter. Die Fenster waren geöffnet, und fröhliche Kinderstimmen mit Klavierbegleitung drangen an mein Ohr. Ich hatte große Lust, zu erkunden, wie hier Unterricht erteilt wird. Je näher ich kam, umso weniger hörte ich Gesang. Offensichtlich gab es inzwischen Unterricht in einem anderen Fach. Ich blieb dennoch bei meinem Vorhaben, klopfte an die Türe des Klassenzimmers, wurde hereingebeten, und betrat den Raum.
Der erste Eindruck beim Betreten des Klassenzimmers, wollte gar nicht zu den fröhlichen Liedern passen, die mich angelockt hatten. Eine hübsche, junge Lehrerin stand an der Tafel, bemüht, etwa dreißig Mädchen und Buben mathematische Regeln zu erklären. Ich wunderte mich nicht allzu sehr über die teilweise entrückten Mienen der Schüler, und das verzweifelte Nagen an den Bleistiften. Erinnerte mich doch die gedämpfte Stimmung der Schüler und der trockene Vortrag der Lehrerin, an manche spröde Mathematikstunde aus der eigenen Schulzeit. Nach einer kurzen Begrüßung der Lehrerin und Kinder, erklärte ich meinen Wunsch, ein wenig am Unterricht teilnehmen zu dürfen. In gebrochenem Englisch erzählte ich, dass ich aus Deutschland komme und hier durch diese wunderschöne Landschaft wandere. Die Lehrerin war einverstanden und bot mir einladend auf einem der kleinen Stühle Platz an. Ich bemerkte durchaus, dass die Kinder, möglicherweise auch die Lehrerin, in meinem Besuch eine willkommene Abwechslung erblickten: Sechzig lebhafte Kinderaugen musterten meine Wanderkleidung, die staubigen Schuhe und den großen Rucksack. Die Lehrerin drehte sich zu mir um, mit der Frage, ob ich auch einen Beitrag zum Unterricht leisten könne? Ich gab zu verstehen, dass ich ihren Mathematik-Unterricht sicher nicht überbieten könne. Seit meiner Kindheit verfügte ich aber über eine besondere Gabe, mit der ich sie und die Schüler sicher erfreuen könne. Dies setze aber voraus, dass der Mathematik-Unterricht für eine kleine Weile unterbrochen werde. Die Lehrerin war überrascht, die Kinder horchten auf. Sie stellte sich aber sehr schnell auf die neue Situation ein und fragte, was ich anzubieten hätte. Erst nach einer befriedigenden Antwort vermöge sie zu entscheiden, ob sie die Erlaubnis geben könne, den Unterricht zu unterbrechen. Aller Augen richteten sich auf mich:
Ich stand auf, machte mit den Armen einige Schwimmbewegungen und sagte in die erwartungsvolle Stille: »Ich kann hier fliegen!« Der Lehrerin verschlug es für einen Moment die Sprache. Einigen Kindern blieb für Sekunden der Mund offenstehen. Dann kamen die ersten Reaktionen: »Das ist nicht möglich, nur Vögel oder Flugzeuge können fliegen!« »Sie wollen doch nicht behaupten, dass Sie hier einfach in der Luft schweben können?«, äußerte die Lehrerin. »Einfach natürlich nicht«, gab ich zur Antwort. Ich kann aber, wenn ich mit Armen und Beinen kräftig rudere, seit meiner Kindheit in der Fantasie fliegen. »Fliegen, fliegen, fliegen!«, schrien die Kinder im Chor und durch einander. »Auf Ihre eigene Verantwortung«, sagte die Lehrerin. Unter heftigem Geschrei, Strampeln und Klatschen der Kinder, ging ich zum Start kurz in die Knie, stieß mich kräftig ab, machte zunächst mit den Armen, dann auch mit den Beinen, einige kräftige Bewegungen, wie beim Brustschwimmen, und erhob mich unter demohrenbetäubenden Lärm der Kinder in die Luft. Dicht am Kopf der Lehrerin vorbei, steuerte ich hinauf zur Decke, drehte einige Runden, segelte auf und nieder, sodass die Kinder in den Schulbänken ihre Köpfe einzogen und flog durch ein offenes Fenster hinaus. Es bereitete mir große Freude, den Aufwind zu spüren, und im Gleitflug den weiten Blick über die sich auf und absenkenden Felder und Fluren bis hin zur Küste mit den anstürmenden Wellen zu genießen. »Juchhe und Hurra« schrie ich laut in den Wind, der mein Rufen zur Schule trug. Dort klebten die Lehrerin und Kinder an den Scheiben und ließen nur das Fenster offen, durch das ich hinausgeflogen war, damit ich auch wieder sicher landen könnte. Einige Male flog ich ganz nahe an der Schule vorbei, um die begeistert winkende Horde zu grüßen. Schließlich setzte ich in einem weiten Bogen zur Landung an, steuerte durch das offene Fenster, drehte noch einmal eine Runde durchs Klassenzimmer und landete unter großem Beifall. Aus Anlass meines Geburtstages, schlug ich dem kleinsten Schüler vor, wenn er keine Angst hätte, dann könne er mit mir eine Runde durchs Zimmer fliegen. Alle Kinder bedrängten ihn: »John, fliege, John, fliege!« Er stimmte nach einigem Überlegen zu. Ich nahm ihn auf den Rücken mit dem Hinweis, sich gut festzuhalten, ging in die Knie und hob mit einem kräftigen Ruck ab. Die Schüler tobten und die Lehrerin hielt sich vor Schreck die Hände vors Gesicht. Ich flog auf und nieder, hin und her, bis ich ein deutliches Zittern des Knaben verspürte. Ohne Schaden zu nehmen, landeten wir direkt vor der großen Tafel, neben dem Pult der Lehrerin. John japste nach Luft und war ganz grün im Gesicht. Ich beugte mich zu ihm hinunter, um ihn vor allen Schülern für seinen Mut zu loben. Doch da nahte das Unheil: John atmete noch einmal tief durch. Dabei rumorte es vernehmlich in seinem Bauch und ehe ich mich zur Seite wenden konnte, bekam ich einen Teil seines Frühstücks ab. » He, das gefällt mir gar nicht, warum spuckst Du mich einfach an«, fuhr es aus mir heraus! John sah mich entwaffnend mit großen, erschrockenen Augen an und stammelte: „Das ist mein – mein – mein – Geburtstagsgeschenk für Dich!« Ich war sprachlos. Und als alle Kinder in den Kanon einfielen: »Viel Glück und viel Segen auf all Deinen Wegen…«, drückte ich den leicht widerstrebenden Knaben einfach an mich und sagte zu ihm: »Es ist alles wieder gut! «
Notdürftig gereinigt, nahm ich meinen Rucksack wieder auf und verabschiedete mich unter dem Beifall der Schüler. Die freundliche Lehrerin wünschte mir für weitere Flüge »Hals und Beinbruch«.
Unsere ganze Wander-Familie, selbst Oli und Artur, waren nach dieser Erzählung überzeugt, dass Opa fliegen kann, wenn nicht wirklich, so doch in der Fantasie. Auch Ihr könnt, ohne Schaden zu nehmen oder anderen Schaden zuzufügen, in der Fantasie viele Abenteuer erleben oder aus Euren Träumen, wie Opa, schöne Geschichten gestalten. Die ersten Flugzeug-Konstrukteure träumten zunächst auch nur davon, wie Vögel fliegen zu können. Dann bauten sie immer bessere Maschinen, mit denen heute viele Menschen wie Oma und ihre Freundin Marie-Luise weltweit unterwegs sind .Allen, die mit Flugzeugen reisen, wünsche ich „Hals und Beinbruch“. Das bedeutet in der Fliegersprache: »Guten Flug und sichere Landung.« Opa Franz rechnet aber auch fest damit, dass einige Urlauber sich entschließen könnten, in diesem Jahr einmal die reizvollen Städte und Regionen der engeren Heimat zu erkunden. Sie werden es sicher nicht bereuen.